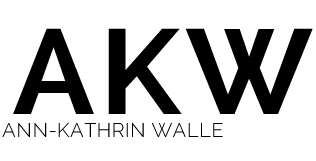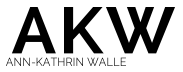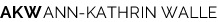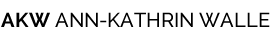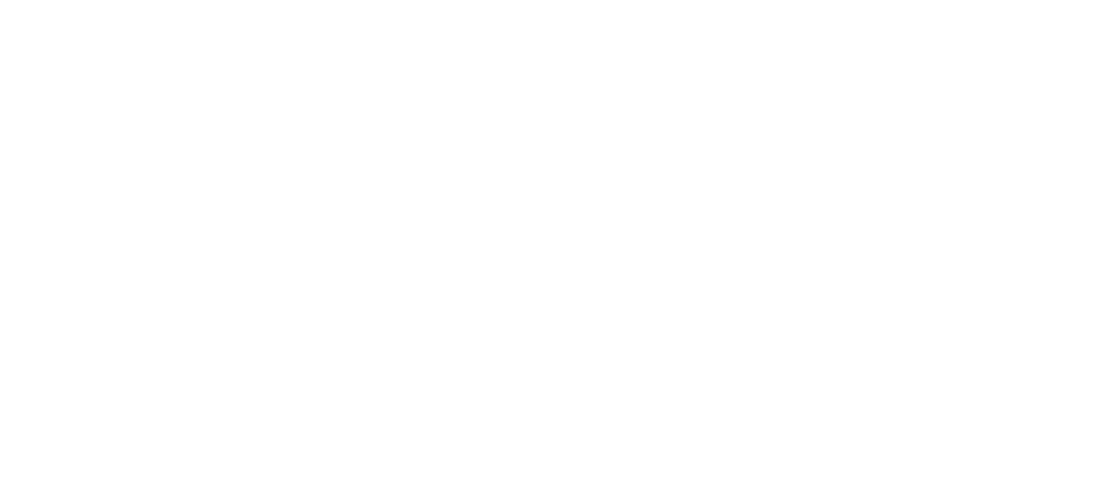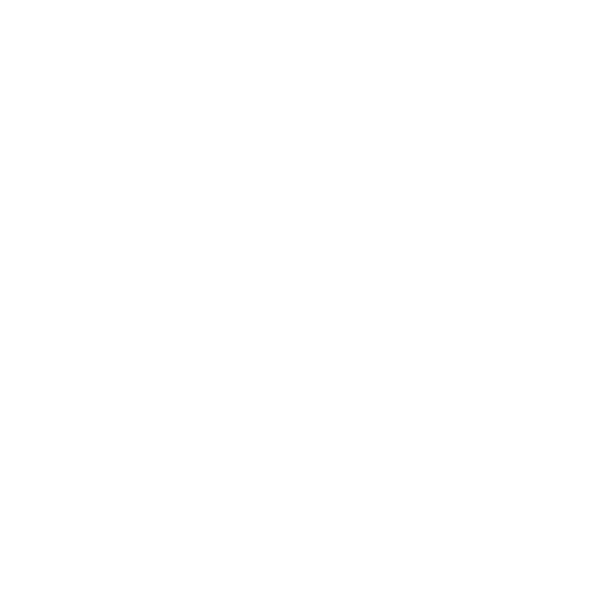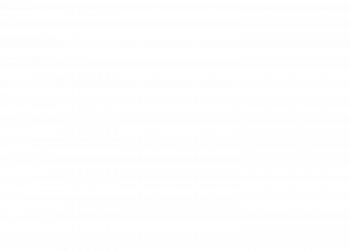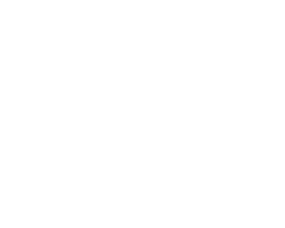Zielsetzung
Die zu beplanenden Grundstücke befinden sich in Hamburg Bergedorf an der Bundesstraße 5 (Bergedorfer Straße), die die Stadtteile Bergedorf, Hamm, Horn und Lohbrügge mit dem Hamburger Stadtkern verbindet. Da Hamburg, wie jede große Metropole wächst und sich auf seine Randgebiete ausweitet, soll nun dieser „vergessene“ Stadtraum, der den Stadtteil – Wohnen und Gewerbe – von einander trennt, mit einem neuen Bindeglied wieder verknüpft werden. Auf der Brache mit perfekter Verkehrsanbindung, Südausrichtung und Nähe zur Bille (Kanal) soll ein neuer qualitativer Raum entstehen, der ein Miteinander von Wohnen und Arbeiten ermöglicht. Zugleich soll der Standort durch die Platzierung von Projekten, die durch eine eventuelle außergewöhnlich formal-ästhetische Wirkung oder wegen ihrer besonderen funktionalen Eigenschaften, aufgewertet werden. Das Projekt soll sich unter anderem auch durch soziale, ökonomische und ökologische Qualität auszeichnen und eine klare Identität und Funktionalität aufweisen, die die Qualität des Raumes erhöht. Mit der Neugestaltung des Raumes sollen neue Nahtstellen bzw. eine intensivere Verzahnung des im Moment getrennten Stadtteils hergestellt werden. Unter energetischen Aspekten besteht das Ziel ein CO2-neutrales „Wohn- und Arbeitsquartier“ zu entwickeln.
Energiekonzept
Der niedrige Heizwärmebedarf soll per Lüftungsanlage und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe gedeckt werden. Zur Erwärmung der Zuluft in den Häusern dient die Sole-Wasser-Wärmepumpe, die über eine 120m tiefe Bohrung an die Wärmequelle der Erdwärme gelangt.
Eine auf den Flachdächern aufgeständerte Solarstromanlage soll über das Jahr sämtlichen verbrauchten Strom generieren. Über jedem Zinnenabschnitt sollen separate Anlagenteile mit einer Fläche von 45,54qm multikristallinen Solarmodulen ihren Platz finden. Daraus ergibt sich eine Gesamtfläche von 728,64qm für alle vier Bauabschnitte. Die Solarstromanlage ist jeder Wohneinheit mit eigenem Wechselrichter und Zähler zugeordnet.
Die Photovoltaikmodule und Flachkollektoren sind außerdem so auf den Flachdächern aufgeständert, dass sie von der Straße kaum einsehbar sind und somit die kubische Form des Baukörpers erhalten.
Die Wärmepumpe soll darüber hinaus knapp die Hälfte des Wärmeverbrauchs decken. Die Außenluft wird in den Wintermonaten über die Lüftungsanlage in das Innere des Hauses geführt, wobei es zuvor über ein Polyethylen-U-Rohr vorgewärmt wird.
Ebenfalls dient eine als Flächenheizung ausgebildete Fußbodenheizung als zusätzliche Regelung der Temperatur. Im Sommer kann dieses System jedoch umgekehrt werden und als Kühlung der Wohnbereiche dienen.
Gebäudekennwerte
Nettogrundfläche – 257,92 qm
Bruttovolumen (V) – 696,4 m
Hüllfläche (A) – 362,88 qm
A/V-Verhältnis – 0,5 m / m
(Werte für einen Abteil der Zinne Werte mal 4 ergibt eine Zinne)
Wohneinheiten – 18
Nutzeinheiten gesamt – 24
Anzahl Nutzer Wohneinheiten – 48
Gebäudehülle
(U-Wert W/qmK)
Außenwand – 0,15
Fenster – 0,8
Dachfläche – 0,1
Boden – 0,17
Gebäudetechnik
Solarstromanlage gesamt – 728,64 qm
Solarstromanlage
ein Zinnenabteil – 45,54 qm
Solare Gewinne pro Jahr – 8803kWh
(Verbrauch 4-Personen-Haushalt – 5000kWh)
Sole-Wasser-Wärmepumpe
Lüftungsanlage
Flächenheizung (Fußbodenheizung)
Schlusswort
Das Wohn- und Arbeitsquartier mit seinen zweigeschossigen Reihenhäusern und mit der simplen Baukörperhaltung passt sich gut in die Umgebung ein. Die vier Gebäudereihen beinhalten je vier bis acht Wohneinheiten mit je drei unterschiedlichen Grundrisstypen, die sich alle nach dem klassischen Solarhausgedanken richten. Hinzu kommen die jeweiligen Büro- und Praxisflächen mit ihren ebenfalls unterschiedlichen Grundrisstypen, die dem ganzen Projekt eine hohe Flexibilität zuweisen.
Diese Felxibilität spiegelt sich, wie zuvor erwähnt, in der äußeren Gestaltung der jeweiligen Fassaden und Garten- bzw. Verkehrsflächen der Gebäudereihen wieder. Durch die nicht parallele und nicht strikte Anordnung der Gebäude auf dem Grundstück ist es gelungen eine Freiraumgestaltung zu erlangen, die eine Trennung von Verkehrs- und PKW-freien Kommunikationsflächen ermöglicht. Die Kommuntikationsflächen oder Treffpunkte ergeben sich aus den ruhigen „Innenhofsituationen“ zwischen den jeweiligen Häuserreihen, die nur zum Teil mit dem PKW befahrbar sind. Darüber hinaus ergeben sich am Rand der Bebauungsfläche Parkreihen, die als gemeinschaftliche PKW-Stellplätze ausgeführt sind.
Trotz der klaren Südorientierung und der relativ dichten Bebauung ergibt sich durch die vielen Faktoren ein einheitliches Gesamtbild. Die unterschiedlich großen Öffnungen in den jeweiligen Fassaden, die Rücksprünge der Fassaden in den verschiedenen Häuserreihen, die Farb- und Schattenwirkung der Klinkerausführung und nicht zu vergessen die leichte Drehung einzelner Reihen, brechen die Gleichheit / Monotonie des ganzen Ensembles. Zu guter letzt spiegelt sich die hohe Flexibilität des Entwurfs nicht nur in den Grundrissvarianten und des Energiegedankens wieder, sondern lässt sich zudem auch in der Freiraum- und Fassadenausführung wiedererkennen.